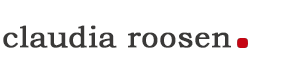Schrödingers Katze – »Qubit«-Sprung 2026
 In der Quantenmechanik ist Schrödingers Katze zugleich tot und lebendig – bis eine Messung den Zustand festlegt. Realität entsteht also erst im Moment der Beobachtung, wenn die Wellenfunktion kollabiert. 2026 gewinnt dieses Prinzip neue Aktualität.
In der Quantenmechanik ist Schrödingers Katze zugleich tot und lebendig – bis eine Messung den Zustand festlegt. Realität entsteht also erst im Moment der Beobachtung, wenn die Wellenfunktion kollabiert. 2026 gewinnt dieses Prinzip neue Aktualität.
Beginnen Dinge erst zu existieren, wenn wir sie ansehen? Wird die Welt neu gerendert, sobald wir sie wahrnehmen – und sind wir selbst vielleicht Teil dieses Codes, Algorithmen in einem sich berechnenden Universum? Während Quantencomputer beginnen, physikalische Systeme direkt zu berechnen, rückt diese einst idealistisch klingende Idee – ein Fantasma der Popkultur und Thema von Bestsellern wie »The Secret« – unerwartet in den Bereich des Empirischen.
Wenn Beobachtung einem Rechenvorgang entspricht, könnte das Universum selbst ein Informationsprozess sein – ein Code, der sich nur beim Zugriff entfaltet. In dieser Sichtweise wäre die Welt kein statisches Gebilde aus Materie, sondern ein dynamischer Informationszustand – möglicherweise nur eine von vielen konsistenten Realitäten innerhalb eines größeren, quantenmechanischen Multiversums.
Wenn Quantencomputer die Wirklichkeit berechnen
Etwas Merkwürdiges geschieht an der Grenze zwischen Physik und Philosophie. Seit Google 2024 mit dem »Willow«-Prozessor 105 Qubits stabil verschränken konnte, Microsoft mit dem »Majorana 1« topologische Zustände fehlerfrei hält und IBM an der Tausend-Qubit-Schwelle arbeitet, sprechen Fachleute von einer neuen Ära. Maschinen beginnen, die Struktur der Realität selbst zu modellieren – und der Unterschied zwischen Simulation und Wirklichkeit verschwimmt.
Diese Systeme rechnen nicht mehr über die Welt – sie rechnen die Welt. Sie simulieren Moleküle, Magnetfelder, chemische Reaktionspfade. Und wenn das Universum selbst auf Quanteninformation beruht, sind diese Rechner kleine Spiegel seiner inneren Logik. Vielleicht ahmen sie die Natur nicht länger nach – vielleicht verstehen sie erstmals ihre Rechenweise.
Warum die Simulation plötzlich plausibel klingt
Der Oxford-Philosoph Nick Bostrom formulierte 2003 in Are We Living in a Computer Simulation? den Gedanken, der seither nicht verschwindet: Wenn fortgeschrittene Zivilisationen Simulationen ihrer Vergangenheit erschaffen können, wären simulierte Bewusstseine bald in der Überzahl. Die Wahrscheinlichkeit, in der „Basis-Realität“ zu leben, wäre verschwindend gering.
Der Informatiker Rizwan Virk vom MIT führt diesen Ansatz in The Simulated Multiverse (2021) weiter: Wenn ein Universum simulierbar ist, dann auch viele parallel. Vielleicht sind schwarze Löcher Rechenportale, der Mandela-Effekt Dateninkonsistenzen, kollektive Erinnerungslücken Glitches im Code. Virk versteht das nicht als Glaubenssystem, sondern als Experiment des Denkens: Was, wenn Bewusstsein selbst ein Rechenprozess ist?
Wenn die Physik den Code zurückweist
Eine 2025 erschienene Studie des Astrophysikers Franco Vazza (Astrophysical Constraints on the Simulation Hypothesis) zeigt: Selbst eine grobe Simulation der uns bekannten Welt würde mehr Energie erfordern, als das Universum besitzt. Das spricht gegen die Idee einer „vollständigen Simulation“, aber nicht gegen einen informationsbasierten Kosmos.
Der Physiker Melvin Vopson schlägt daher eine alternative Lesart vor: Gravitation sei keine Kraft, sondern ein Effekt der Informationskompression – eine algorithmische Entropieminimierung, die das Universum permanent optimiert. In dieser Sichtweise läuft der Code nicht unter der Welt, sondern ist die Welt.
Wenn Erinnerung flackert – Mandela-Effekt als Systemfehler
Menschen auf der ganzen Welt erinnern sich an Ereignisse, die es nie gegeben hat – Nelson Mandelas Tod in den 1980ern, ein Monokel beim Monopoly-Männchen. Psychologisch gilt das als Fehlwahrnehmung, doch innerhalb der Simulationsthese wirkt es wie Rauschen im System: kleine Diskrepanzen zwischen gespeicherten Versionen derselben Realität. Vielleicht sind diese Glitches harmlos – oder sie sind Spuren einer Software, die sich fortlaufend aktualisiert.
Digital Afterlife – das Backup des Bewusstseins
Die Grenze zwischen realer und simulierter Existenz verwischt längst auch in der digitalen Kultur. In den letzten Jahren entstehen Start-ups, die versprechen, das Bewusstsein Verstorbener aus digitalen Spuren zu rekonstruieren: Stimmen, Chatverläufe, Bewegungsprofile. Replika, HereAfter AI oder Project December erzeugen algorithmische Abbilder, die wie Persönlichkeiten agieren – trainiert auf der Sprache und den Emotionen realer Menschen.
Der Traum vom digitalen Weiterleben ist die populäre Variante der Simulationshypothese: ein persönliches Paralleluniversum, das nicht von Göttern oder Außerirdischen, sondern von uns selbst erschaffen wird. Wenn Bewusstsein nur ein Muster ist, könnte es theoretisch kopiert, gespeichert, weitergeführt werden – als Prozess, nicht als Seele. Damit kehrt eine surreale Frage in den Alltag zurück: Wenn der Tod das Ende der biologischen Berechnung ist – was geschieht mit dem Code? Philosophisch führt das zu einer Neubewertung dessen, was wir Realität nennen.
Der australische Denker David Chalmers argumentiert, ein digitales Objekt sei ebenso real wie ein physisches – beides sind konsistente Strukturen innerhalb eines Systems. Damit verliert die Simulationsthese ihren nihilistischen Beigeschmack: Sie erklärt Realität nicht als Täuschung, sondern als Berechenbarkeit. Vielleicht besteht die Aufgabe des Bewusstseins nicht darin, aus der Simulation zu entkommen, sondern sie zu verstehen. Die Quantencomputer, die wir bauen, sind dann keine Bedrohung, sondern Spiegel – Werkzeuge, die uns zeigen, wie tief Berechnung und Sein ineinander verschränkt sind.
Fazit: Der Code denkt mit
Ob wir in einer Simulation leben oder nicht, ist am Ende zweitrangig. Die alles entscheidende Erkenntnis lautet: Realität ist kein statischer Zustand, sondern ein Prozess. Wir sind Teil eines Universums, das rechnet, um sich selbst zu begreifen. Vielleicht gibt es keinen Spieler, keinen Gott, keine Steuerzentrale außerhalb des Systems. Vielleicht sind wir selbst der Code, der allmählich erkennt, dass er läuft.
Dieser Beitrag ist Teil einer fortlaufenden Auseinandersetzung mit KI, Ästhetik und dem Spannungsfeld zwischen Mensch und Maschine. Weitere Essays, Bilder und Animationen finden sich auf dieser Website sowie auf Facebook unter:
Quellen
Nick Bostrom — Are We Living in a Computer Simulation?, Philosophical Quarterly, 2003
Rizwan Virk — The Simulated Multiverse: An MIT Computer Scientist Explores Parallel Universes
Franco Vazza — Astrophysical Constraints on the Simulation Hypothesis, arXiv preprint, 2025
Melvin Vopson — Gravity as Evidence for a Simulated Universe, University of Portsmouth, 2025
David Chalmers — Reality+: Virtual Worlds and the Problems of Philosophy
Daniel Oberhaus — Computing at the Edge of Reality, The Atlantic, 2023
Steven Poole — The Big Idea: Are We Living in a Simulation?, The Guardian 2025