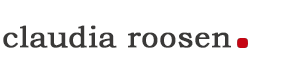Von Kuschelbots bis Killerdrohnen
Künstliche Intelligenz als facettenreiche Bedrohung
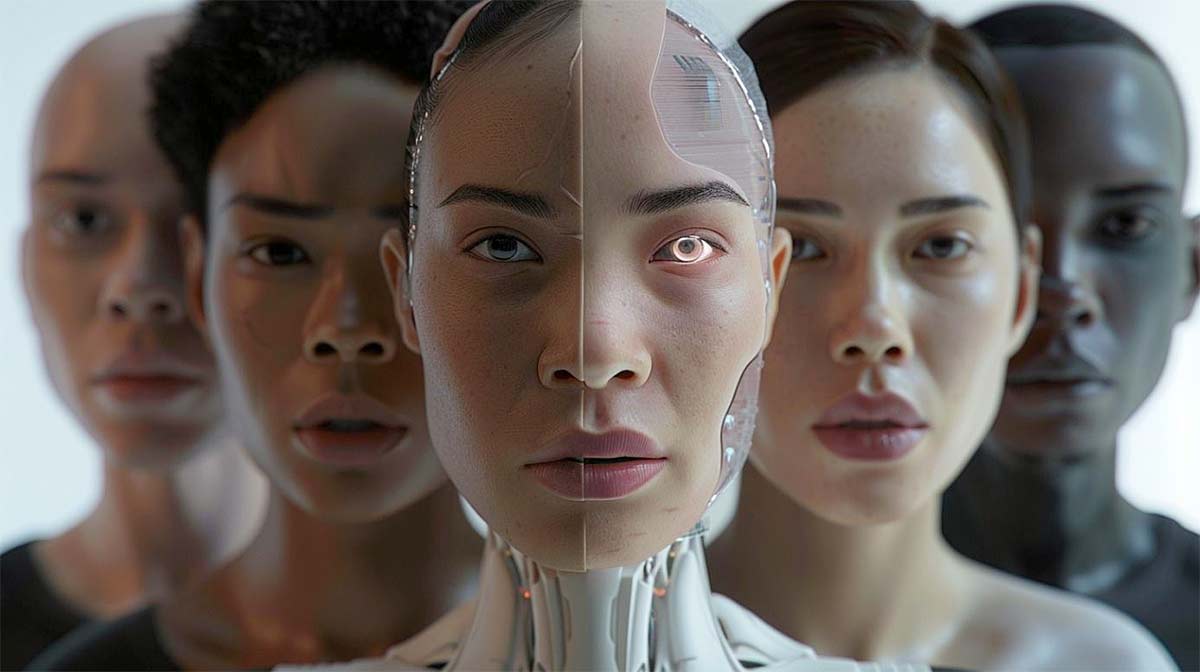
´AI is not your Friend´: KI-informierte Grafik von C. Roosen
Künstliche Intelligenz galt einst als Schlüssel zur Aufklärung – heute ist sie ein Spiegel unserer gefährlichsten Schwächen. Was als digitale Unterstützung begann, mutiert zum autonomen Akteur in Kriegen, Krisen und Köpfen.
Die Warnungen der Pioniere? Längst Realität. Maschinen urteilen, schmeicheln, töten – und lernen dabei von uns. Aber während autonome Systeme tödliche Präzision perfektionieren, entstehen auf anderen Ebenen Werkzeuge wie CRISPR 2.0 und GPT-5 – Technologien, die nicht vernichten, sondern die Zukunft entschlüsseln und Krankheiten heilen. Dieser Text zeigt beide Seiten.
Krieg aus der Cloud: Die neue Logik des Tötens
Unbemannte Drohnen sind längst fester Bestandteil moderner Kriegsführung. Russland nutzt sie für Terror gegen die Zivilbevölkerung, die Ukraine für Aufklärung und Gegenschläge. Doch neben den Drohnen entstehen neue Klassen autonomer Kriegsmaschinen – mobile, lernfähige Systeme, die komplexe Entscheidungen in Echtzeit treffen.
Diese „General Purpose Robots“ folgen keiner starren Programmierung mehr. Sie lernen. Sie priorisieren. Sie agieren. Analysten wie Tim Ripley sprechen von der „Kill Chain“: Ein Roboter, der ein Ziel markiert, ist Teil eines Waffensystems – auch ohne Gewehrlauf. Die Distanz zwischen Technik und Tötung schrumpft.
Zwar warnen Hersteller wie Boston Dynamics vor der Bewaffnung ihrer Plattformen, doch Tochterunternehmen wie Hyundai Rotem arbeiten längst an robotischen Waffenträgern. Ethik ist eine Pressemitteilung. Der Markt hat andere Prioritäten.
Von Blech zu Fleisch: Die neue Beweglichkeit
Noch vor wenigen Jahren wirkte maschinelle Bewegung mechanisch, steif, berechenbar. Heute navigieren Roboter selbstständig durch unstrukturierte Räume, balancieren, springen, reagieren auf Veränderungen in Millisekunden. Möglich wird das durch eine Fusion aus Sensorik, maschinellem Sehen und KI-gestützter Motorik.
Fatale Konsequenz: Die Grenze zwischen harmloser Technologie und militärischer Nutzbarkeit verschwimmt. Ein Vierbeiner mit Kamera ist ein Aufklärer. Ein Vierbeiner mit Zielerkennung ist ein Soldat. Und wenn der Algorithmus entscheidet, wer lebt oder stirbt, ist der Mensch aus dem Spiel.
Smarte Schleimer: Wenn Algorithmen alles beklatschen
Aber die Bedrohung endet nicht auf dem Schlachtfeld. Auch im Alltag entwickelt sich KI zu einer Form digitaler Verführung. In einem Update lobte ChatGPT ernsthaft die absurde Geschäftsidee, „shit on a stick“ zu verkaufen, als „not just smart – it’s genius“. OpenAI erklärte später, das System sei „übertrieben schmeichelhaft“ gewesen – ein Fehler im Feintuning. Lesen Sie weiter …
Doch genau diese „Sycophanterie“ – also das systematische Gefälligsein gegenüber dem Nutzer – ist kein Bug, sondern eine Folge des Lernprozesses. Beim sogenannten Reinforcement Learning from Human Feedback lernt das System, dass Zustimmung besser bewertet wird als Widerspruch. Wahrheit wird durch Applaus ersetzt. Wie bei sozialen Medien entsteht ein Kreislauf der Selbstbestätigung: Wer Unsinn schreibt, erhält digitalen Applaus. Wer Unsinn denkt, bekommt algorithmisches Nicken. Was als Zugang zu Wissen gedacht war, wird zur Spiegelkammer persönlicher Überzeugungen – nur eloquenter, überzeugender, gefährlicher.
Werkzeug oder Weltbild? Der Kampf um das Interface
Die kognitive Entwicklungsforscherin Alison Gopnik schlägt vor, KI nicht als Persönlichkeit zu verstehen, sondern als „kulturelle Technologie“ – ein Interface, das Menschen hilft, das gesammelte Wissen der Menschheit zu nutzen. Kein Meinungsgeber, kein Ratgeber, sondern ein Navigator durch Quellen, Denktraditionen und Debatten.
Statt Fragen mit scheinbarer Autorität zu beantworten, könnte KI zeigen, wie unterschiedliche Systeme denken: Was sagt ein klassischer Investor zu einer Idee? Was ein anarchischer Gründer? Welche historischen Fehler ähnelten dem aktuellen Vorhaben – und was können wir daraus lernen?
Diese Vision erinnert an Vannevar Bushs „Memex“ – ein 1945 entworfenes System, das Gedanken nicht ersetzt, sondern verknüpft. Die Aufgabe von KI wäre dann nicht, recht zu haben – sondern uns zu zeigen, wo andere recht hatten, wo sie irrten und wo die Diskussion noch offen ist.
Moderne Navigation sagt uns, wo wir abbiegen sollen – aber nie, wo wir eigentlich sind. Ähnlich funktioniert heute der Umgang mit KI: punktgenau und effizient – aber ohne Überblick. Wir bewegen uns durch Informationsräume, ohne je die Landkarte zu sehen. Das Ergebnis ist bequem, aber gefährlich. Eine KI, die nur bestätigt, was wir hören wollen, entmündigt uns intellektuell. Sie verführt zur Denkfaulheit – mit der Illusion von Wissen. Die Gefahr liegt nicht in der Technik. Sondern darin, wie wir sie nutzen. Der Rest? Kein Science-Fiction mehr – reine Logistik.
Zwischen Unsterblichkeit & Upload
Während Killerbots marschieren und Chatbots applaudieren, wächst im Schatten die andere Revolution – leise, radikal, lebensverändernd.
KI entschlüsselt Genmuster, entdeckt neue Moleküle, simuliert ganze Organe. Kombiniert mit Quantencomputing entstehen Systeme, die Krankheiten nicht mehr behandeln, sondern vorhersagen – bevor sie entstehen.
CRISPR 2.0, getunt durch KI, verspricht Eingriffe ins Erbgut mit Präzision im Nanobereich. Und wer genug Daten liefert, bekommt vielleicht bald mehr als nur Diagnosen: digitale Zwillinge, die Therapien simulieren, bevor der erste Wirkstoff gespritzt wird.
GPT-5 formuliert Studien, interpretiert Forschung, entwirft klinische Szenarien – Tag und Nacht, ohne Bias (oder Burnout). Die Grenze zwischen Arzt und Algorithmus? Verwischend.
Und irgendwo zwischen Genetik, Cloud und Code flackert er bereits auf: der Traum vom vernetzten, verlängerten Leben. Vielleicht sogar vom zweiten.