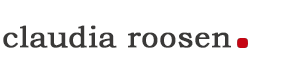Dies ist keine Technik. Sondern ein Medium.
Warhol hätte sie geliebt. Oder verklagt.

Warhol x Gothic – Midjourney by C. Roosen
Als Jason Allens Théâtre D’opéra Spatial beim Colorado State Fair den 1. Preis in der Kategorie Digitale Kunst gewann, war die Reaktion vorhersehbar. Das sei keine Kunst, so der Tenor – und zugleich: Das werde sie ablösen. Allen selbst erklärte der New York Times: „Kunst ist tot.“ Und schob nach: „Die KI hat gewonnen. Die Menschen haben verloren.“ Aber stimmt das?
Fakt ist: KI ist das neue Chamäleon der Kreativität. Sie analysiert, rekombiniert, simuliert Stile, die wir einst für zutiefst menschlich hielten. Mal entsteht daraus ein atemberaubendes Bild, mal beliebiger Abklatsch. Und immer löst es etwas aus: Faszination, Ablehnung oder das Gefühl, dass hier gerade etwas Entscheidendes kippt. Denn während der Mensch oft mit Dämonen des Zweifels ringt, kennt die KI solche Dramen nicht. Sie sortiert, analysiert – rasend schnell, mühelos, ohne jedes Wagnis. Ist das dann noch Kunst? Und wer beansprucht sie für sich?
Die Kopie als Konkurrenz
Die internationale Kunstwelt befindet sich aktuell in einem existenziellen Kampf. Generative KI-Programme wie Midjourney und DALL·E basieren auf Werken, die von Menschen geschaffen wurden – ohne deren Zustimmung. Und die Maschinen drohen nun, genau jene Kunstschaffenden zu ersetzen, deren Arbeiten sie als Grundlage nutzen. Die Skepsis ist berechtigt – doch viele der kursierenden Argumente sind widersprüchlich oder leisten keinen substanziellen Beitrag zur Verteidigung des Menschlichen. Und unterschätzen das kreative Potenzial des Mediums.
Absicht ist kein Argument
Die Diskussion um KI-Kunst kreist oft um die falsche Prämisse. Selbst wenn generative KI beeindruckende Designs und spielerische Prosa auf Knopfdruck hervorbringt, lautet das Gegenargument vieler: Kunst müsse aus Absicht entstehen – und das könne eine Maschine nicht leisten. Doch auch dieses Argument greift zu kurz. Künstler:innen haben immer schon mit Algorithmen, Zufall und Strukturbrüchen gearbeitet – kalkuliert, konzeptuell, oft bewusst antirational. KI ist in diesem Zusammenhang nicht das Ende der künstlerischen Intention, sondern ein neuer Resonanzraum. Wer sie vorschnell als „kreative Leere“ abtut, verkennt sowohl die Technologie als auch das menschliche Vermögen, sie produktiv zu nutzen.
Der magische Moment im Textfeld
Was dabei oft übersehen wird: die stille Dramatik des richtigen Befehls in Midjourney. Der Moment, in dem sich – nach endlosen Nuancierungen, verworfenen Varianten und fein austarierten Parametern – das vage Bild im Kopf in eine stimmige, fast zwingende Form übersetzt. Aus Intuition wird Entscheidung, aus Ahnung ein schöpferischer Akt. Die Sprache der Maschine ist Englisch – präzise, semantisch verdichtet. So entstand der Prompt für das Titelbild:
Jenna Ortega as Wednesday Addams, iconic pop art triptych inspired by Andy Warhol, silkscreen effect with subdued neon tones, symmetrical braids, vintage gothic school uniform, hauntingly calm expression with an unreadable gaze – poised between innocence and menace. Repeated three times in horizontal alignment, each panel set against a contrasting yet slightly desaturated background. Front-facing portrait, minimalistic graphic texture, imbued with quiet tension and stylized stillness.
Die KI ist in dieser Logik kein Bruch, sondern eine Fortsetzung – ein Instrument wie Pinsel, Kamera oder Sampling-Tool. Sie eröffnet neue ästhetische Räume, die weder rein menschlich noch rein maschinell sind, sondern etwas Drittes: geheimnisvoll, fließend und hybride.
Der Algorithmus als Kunstgriff
Midjourney zählt zu den feinsten Text-zu-Bild-Generatoren überhaupt. Entscheidend ist nicht das Medium selbst, sondern das, was sich durch Sprache entfalten lässt. Die Kunst der Worte formt die Kunst der Bilder. Daraus entsteht ein neuer Handlungsraum für alle, die mit dieser Technologie schöpferisch umgehen. Der Zufall war oft ein Kunstgriff. Jetzt ist er ein Algorithmus. Und während manche die KI als Blackbox verdammen, erkennen andere in ihr genau das: eine neue Bühne für Fantasie – und einen Slot für kalkulierten Kontrollverlust.
Der Urheber ist tot – es lebe der Datensatz?
Wem aber gehört das Ergebnis, den Maschinen oder den Codierenden? Die Debatte um Urheberrechte ist dabei nicht länger nur eine juristische Frage, sondern auch eine moralische. Denn die KI lernt nicht neutral. Sie zapft Archive an, die ihr nie gehörten. Und viele der Künstler:innen, auf deren Schultern sie steht, bekommen nichts dafür zurück. Trotzdem: Wer meint, KI könne keine Kunst erzeugen, weil sie kein Bewusstsein habe, verkennt die Dynamik von Mediengeschichte. Die Fotografie wurde einst als Anti-Kunst verlacht. Der Film galt lange als Technikspielerei. Heute hängen KI-Bilder in Galerien, gewinnen Wettbewerbe und provozieren Diskussionen, die weit über ästhetische Fragen hinausgehen.
Vom Flimmern zum XXL-Format
Moderne Produktionsstätten wie die Oberhausener Transfer-Unit Signworks verstehen sich nicht mehr als klassische Druckereien, sondern als Mittler zwischen Datenstrom und Artefakt. Dort durchlaufen KI-generierte Werke den Druck wie einen letzten Akt der Verwandlung. Was hier entsteht, ist mehr als bloße Reproduktion.
Ob Fine Art Print oder transluzente Leuchtkasten-Ästhetik: Jede Oberfläche verändert die Wahrnehmung des Motivs: mal klar und reduziert, dann wieder mit Kontrast und Tiefe. So entsteht ein mehrschichtiger Dialog zwischen Code und Körperlichkeit – ein Bild, das im Auge des Betrachters changiert und sich facettenreich erfahren lässt.
Die Zukunft malt nicht. Sie remixt.
Was wir erleben, ist weniger ein Ende als ein Übergang. Die KI fordert das Menschliche nicht heraus – sie beleuchtet es bloß neu. Denn Kreativität war nie an ein bestimmtes Werkzeug gebunden. Ob Pinsel, Kamera, Siebdruck oder Prompt – Kunst beginnt dort, wo sich Form und Absicht berühren. Natürlich darf man darüber streiten: über Urheberschaft, Originalität, Autonomie. Aber genau das hat auch die Pop-Art getan – mit Suppendosen und einer Prise Ironie.
Warhol würde KI-Kunst vielleicht lieben. Sie in ein Raster aus Neonfarben legen. Oder ihr eine Abmahnung schicken. Und Wednesday Addams, die in Gothic-Filmen nie eine Miene verzieht? Die hätte vermutlich nur kurz geblinzelt.
🏆 KI-Kunst als Sammlerobjekt
– Théâtre d’Opéra Spatial von Jason Allen gewann den 1. Preis für Digitale Kunst auf der Colorado State Fair – mit einem Werk, das per Prompt in Midjourney entstanden ist.
– Portrait of Edmond de Belamy, geschaffen mit einem generativen Algorithmus, wurde für über 430.000 Dollar versteigert.
– Der humanoide Roboter Ai‑Da erzielte mit einem KI-generierten Porträt von Alan Turing über eine Million Dollar.
– Das Projekt Botto, gesteuert durch DAO-Abstimmungen, erzielte mit KI-generierter Kunst bisher mehr als 5 Millionen Dollar Umsatz.
– Der Künstler Refik Anadol bringt KI-gestützte Bildwelten in Museen, immersive Räume und den internationalen Kunsthandel – unter anderem mit Werken wie Machine Hallucinations oder Unsupervised.
Diese Entwicklungen zeigen: KI-Kunst ist längst mehr als Stil oder Spielerei. Sie ist Markt, Medium und Manifest. Doch was bleibt vom Künstler, wenn der Prompt das Werk schreibt? Die Antwort auf diese Frage formuliert sich in jedem Werk neu.

Aktuelle Arbeiten der Verfasserin: https://extrawerke.de/claudia-roosen-werke/
Dieser Beitrag ist Teil einer fortlaufenden Auseinandersetzung mit KI, Ästhetik und dem Spannungsfeld zwischen Mensch und Maschine. Weitere Essays, Bilder und Perspektiven unter: